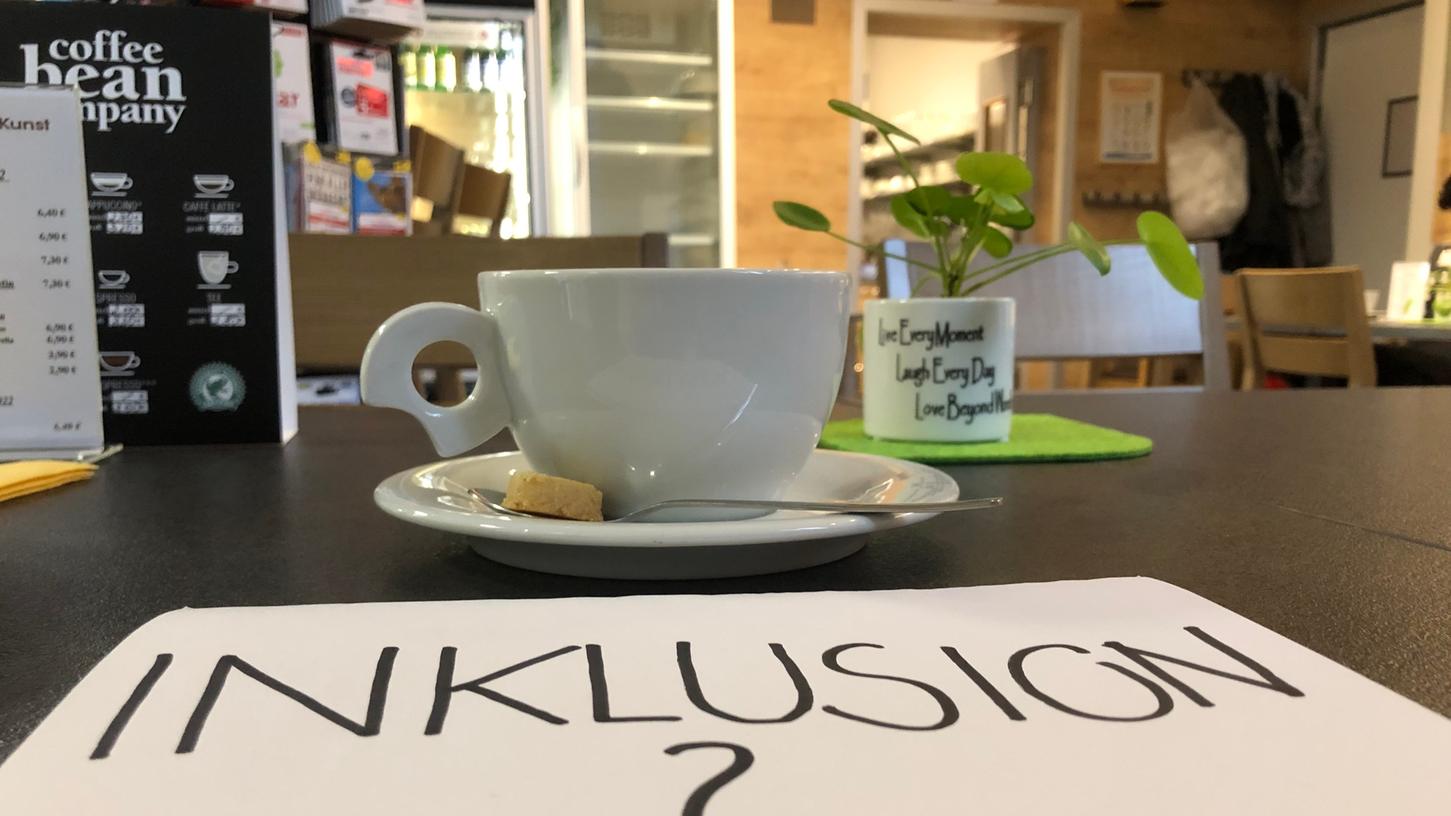
Vortrag mit Diskussion
Gespräch und Debatte in Roth: Was eine Party für alle mit Inklusion und Chancengleichheit zu tun hat
Wie kann eine inklusive Gesellschaft aussehen? Was fehlt zu einem gelungenen Miteinander und wo gibt es bereits gute Beispiele? Diese und weitere Fragen will eine Veranstaltung der Lebenshilfe Schwabach-Roth am Dienstag, 26. September, 18 Uhr, in den Ratsstuben von Schloss Ratibor aufgreifen. Das Motto: „Inklusion gemeinsam gestalten“. Ideen und Impulse zur weiteren Diskussion gibt als Gastreferentin Prof. Dr. Elisabeth Wacker, die sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt.
Frau Dr. Wacker - Sie sind eine anerkannte Fachfrau für Fragen rund um „Inklusion“, haben viel darüber geschrieben und referiert. Wie würden Sie „Inklusion“ jemandem erklären, der mit dem Begriff so gut wie gar nichts anfangen kann?
Ja, tatsächlich begleitet mich das Thema durch mein Leben; aber genau genommen ist es eine Mainstreamaufgabe, die alle etwas angeht.
Wie ich Inklusion verstehe, wird vielleicht an folgendem Bild deutlich: Sie sind zu einer Party geladen. Aber nicht nur zum Zuschauen. Sondern auch zum Mittanzen. Jemand fordert Sie auf oder Sie können andere auffordern, mit Ihnen zu feiern. Also kurz und knapp: Inklusion ist keine Frage der Großzügigkeit, sondern eine Selbstverständlichkeit, nämlich - wie bei einer Party - zusammen zu sein; Kommunikation findet statt, Türen öffnen sich. Das bedeutet, dass Zutritt und Zusammengehörigkeit in Einklang sind. Unabhängig von Merkmalen, wie Alter, Geschlecht, Religion, Herkunft, Beeinträchtigung oder Ähnlichem, die die Menschen eventuell unterscheiden. Inklusion ist immer Gemeinschaftssache. Und nicht die Aufgabe Einzelner. Darum ist es gut, wenn wir alle uns damit beschäftigen.
Sie beschäftigen sich mit dem Thema Inklusion, da wussten viele noch nicht einmal, etwas mit diesem Begriff anzufangen. Gab und gibt es dafür einen Grund oder auch ein Erlebnis, warum Sie sich ausgerechnet damit so intensiv auseinandersetzen?
Zwei konkrete Erfahrungen aus meiner Schul- und Studienzeit und eine generelle Überlegung spielen dabei eine wesentliche Rolle.
Dass Gesellschaft gemeinschaftlich handeln sollte und dafür die Richtungen aushandeln, trägt unser Wertegerüst. So habe ich das von klein auf erlebt und gelebt.
Den einen konkreten Grund, warum mir Inklusion wichtig ist, habe ich erst viel später verstanden: Ich bin in einem Nürnberger Humanistischen Gymnasium durch die Schulzeit gegangen. In meiner Klasse war eine Mitschülerin, die wegen der Glasknochenkrankheit einen Rollstuhl nutzte. Unsere Klasse war vor diesem Hintergrund sozusagen privilegiert; niemals waren wir „Wanderklasse“, mussten also für Unterrichtsstunden umziehen. Immer hatten wir ein Klassenzimmer im Parterre und das war auch in der Pause geöffnet. Das fanden wir super und bequem. Niemand hat darüber nachgedacht, dass es eigentlich um die praktizierte Teilhabe am Unterricht einer Schülerin ging. Sie war ja eine von uns. Bei Klassenfahrten oder anderen Unternehmungen, später auch bei Wirtshausbesuchen, dachten wir viel nach, wie sie auch dabei sein könnte. Uns bewegten dabei tatsächlich in erster Linie rein praktische Überlegungen; also beispielsweise, ob die Bustür breit genug ist für ihren ,Rolli‘. Es war einfach keine Diskussion, sondern immer klar: Sie sollte mit dabei sein. Das war kein Mitleid. Sondern einfach, weil wir zusammen etwas unternehmen wollten.
Dieser alltäglich-selbstverständliche Umgang ist an sich die beste Gelegenheit, um Teilhabekompetenz im Miteinander aufzubauen. Meiner Schule sei Dank dafür!
Der zweite konkrete Anlass, mich dem Thema Inklusion intensiver anzunehmen, war einige Jahre später mein Einstieg als Forscherin.
Im Auftrag der Bundesregierung erforschte und untersuchte ich in einem Tübinger Team viele Jahre bestimmte Arbeitssituationen mit dem Blick auf „Humanisierung des Arbeitslebens“. Mein Arbeitsschwerpunkt lag auf „Arbeit im Behindertenheim“ – so hieß das damals. Dazu habe ich auch promoviert.
Im Lauf dieser Forschung wurde mir klar: hier gibt es nicht nur ,Arbeitskräfte‘ in der ,Behindertenhilfe‘, sondern es geht um ganz verschiedene Menschen, die dort wohnen, also einen großen Teil ihres privaten Lebens verbringen. Hier sollte nicht eine Organisation den Takt angeben, sondern Selbstbestimmung beim Wohnen.
Die Leidenschaft, auf diesem Aufgabenfeld mehr zu machen und zu verstehen, begleitet mich seitdem. Und ich teile sie gerne mit Anderen, die sich dafür ebenfalls engagieren wollen.
Gefühlt ist der Begriff der Inklusion und die Frage, wie sie umgesetzt werden kann, erst seit ein paar Jahren so richtig in der öffentlichen Diskussion. Menschen mit Beeinträchtigungen - gleich ob psychisch oder physisch - gab es dagegen schon immer. Wie passt das zusammen?
Wir machen es uns leicht – und das hat seine Vorteile. Wenn Sie in einen Aufzug steigen oder über eine Brücke gehen, verlassen Sie sich darauf, dass hier der TÜV geprüft hat. Das sind Annahmen oder - wenn man so will - Schubladen. ,Wir reduzieren Komplexität‘, sagt dazu die Fachwelt.
Wenn wir es uns also leicht machen wollen, sortieren wir Menschen nach Kategorien. Wenn man das mit Bewerten verbindet – also jemand ist weniger wert, weil sie oder er zu einer bestimmten Gruppe zählt - ist es diskriminierend.
Wenn wir ,die Behinderten‘ denken oder sagen, dann werfen wir sehr unterschiedliche Menschen in einen Topf, denn sie können sehr unterschiedliche Beeinträchtigungen haben und dazu auch ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht haben. Letztlich sollten wir die ,Sortiererei‘ lassen und stattdessen darüber nachdenken, wann Verschiedenheit zum Nachteil wird.
Wenn nämlich Beeinträchtigung, wie etwa beim Sehen, Hören, Gehen, Denken, im Verhalten, benachteiligt wird, dann entsteht Behinderung. Daher müssen wir sehr viel lernen, wie man gut mit dieser Vielfalt umgehen kann - statt sie verstecken oder entfernen zu wollen.
Sie plädieren und arbeiten für eine Gesellschaft, die noch weit mehr als bisher inklusiv lebt. Wie meinen Sie das, wenn Sie sagen, dass Inklusion alle angeht und betrifft?
Inklusivität in der Gesellschaft achtet die Unterschiede, zwingt aber nicht zur Gleichmacherei. Das bedeutet auch, dass es richtig sein kann, wenn jemand privilegiert wird, um Hürden - gleich welcher Art - aus dem Weg zu räumen. Behindertenparkplätze sind so ein Beispiel, aber auch Frauenparkplätze in Parkhäusern oder wenn es extra Aufzüge gibt für Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen.

Der Abbau von Barrieren macht den Weg frei dafür, Chancengerechtigkeit für alle zu verbessern. Hier können wir sensibler werden.
Es geht nicht darum, dass alle das Gleiche tun oder lassen sollen, sondern darum, dass alle selbstbestimmt und so selbstständig wir möglich ihre Potenziale entfalten können. Darauf haben wir uns kulturell an sich verständigt. Also keine Fürsorge, sondern Aufmerksamkeit für Chancengerechtigkeit und Investition, damit das gelingen kann.
Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke hat Mitte August in einem Fernsehinterview unter anderem die inklusive Beschulung von Kindern mit Behinderung als „Ideologieprojekt“ bezeichnet. Wenn Sie so etwas hören oder lesen - was geht da in Ihnen vor?
Nur Empörung wäre zu kurz gegriffen. Es ist ein Weckruf an alle, noch mehr Aufmerksamkeit auf mögliche Diskriminierung und Exklusion zu richten. Dem Herrn selber würde ich unser Grundgesetz zur Lektüre empfehlen (Art. 3,3). Das ist keine Spielwiese für Ideologien. Keiner darf wegen Verschiedenheit benachteiligt werden. So lautet unser fundamentales gesellschaftliches Bekenntnis.
Auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis zehn (sehr schlecht): Wo stehen wir in Deutschland mit der Inklusion?
Deutschland müht sich sehr um Teilhabe. Es hat noch nicht so ganz im Griff, wie sehr Inklusivität in allen gesellschaftlichen Bereichen Fuß fassen muss. Da hilft es nicht, die Behindertenbeauftragte zu beauftragen, also zu delegieren. Wir haben mal ein Jahr lang eine Stadt in Nordrhein-Westfalen in ,Inklusivität‘ geschult. Und auf einmal waren in der Verwaltung viele eingebunden, die das nie auf dem Schirm hatten – so findet Veränderung statt. Und die Teilnehmenden haben ganz neue Formen der Beteiligung für sich entdeckt.
Als Deutschland – sehr zügig – die Behindertenkonvention ratifizierte, hat man sich wohl ein wenig verschätzt im eigene Ranking. Aber das ist dann der Anreiz, immer besser zu werden. Die Richtung ist schon erkannt.
Kurz: Ich denke in Noten an ein „befriedigend“. So der Stand heute. Deutschland ist noch kein Musterschüler. Hat aber Potenzial!
Anmeldung zu Impulsvortrag mit Diskussion
Anmeldung zu Impulsvortrag mit Podiumsdiskussion der Lebenshilfe Schwabach-Roth: Dienstag, 26. September, 18 Uhr, Schloss Ratibor (Raststuben) unter www.lebenshilfe-schwabach-roth.de
Prof. Dr. Elisabeth Wacker (*1954) forscht zu den Themen Umgang mit sozialer Ungleichheit, Vielfalt und Verschiedenheit bei Beeinträchtigung und Behinderung in der Gesellschaft.
Sie studierte an der Universität Tübingen u.a. Theologie, Philosophie und Soziologie (Dr. rer. soc.). Nach Aufbau und Geschäftsführung der Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung der Universität Tübingen „Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen“ folgte Wacker 1996 dem Ruf auf den Lehrstuhl Rehabilitationssoziologie an der Technischen Universität Dortmund. Gastprofessuren führten sie nach Wien, Pingtung und Taipei (Taiwan).
Prof. Wacker hat seit 2011 den Vorsitz des Wissenschaftlichen Beirats zum Bericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Behinderung. Seit Januar 2013 ist sie Inhaberin der Professur für Diversitätssoziologie an der Technischen Universität München.






Keine Kommentare
Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.
0/1000 Zeichen